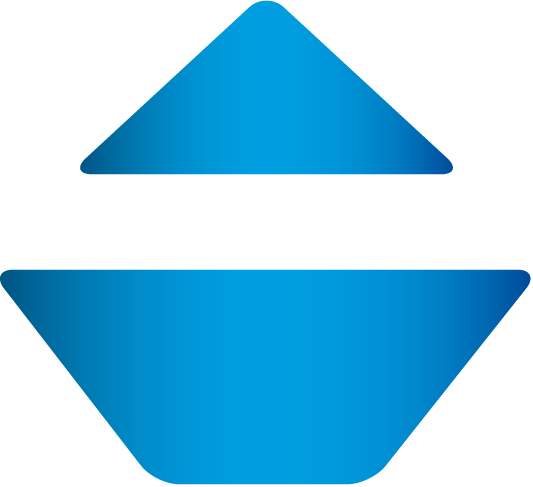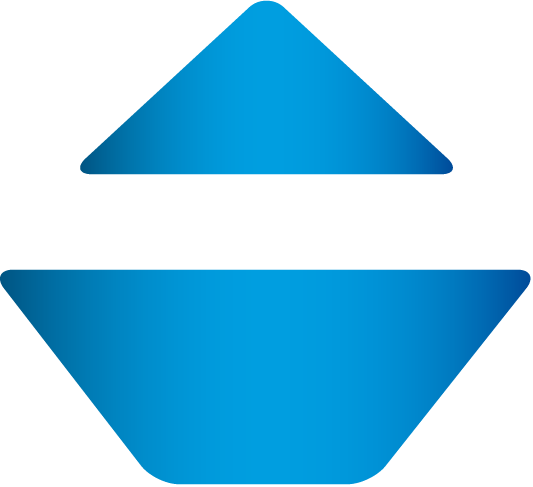Female Leadership: eine grundlegende Herleitung
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland immer noch nicht signifikant erhöht. Trotz vielfältiger Bemühungen. Während es bei Diversität in Führungsrollen vor dem Jahrtausendwechsel vor allem um eine soziale Wünschbarkeit ging, gesellen sich spätestens mit der digitalen Transformation auch klare ökonomische Notwendigkeiten hinzu: die zunehmende Komplexität des Wandels lässt sich nur dann nachhaltig bewältigen, wenn es zu einer Verknüpfung diverser Qualitäten in der Führung kommt. Dieser Artikel leitet eine die Idee von „Female Leadership“ her.
Wofür braucht es Female Leadership?
Genau genommen könnte man zuerst mal fragen, wofür es Führung generell braucht. Aus einer sehr übergeordneten Perspektive würde ich sagen: immer da, wo Menschen zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, braucht es Führung. Jemand orchestriert, koordiniert, motiviert und inspiriert die Gruppe (mit deren Erlaubnis), um die Zielerreichung zu sichern.
Daran angelehnt bedeutet Female Leadership ganz einfach: Führung ausüben im Einklang mit seinen weiblichen Fähigkeiten und Ressourcen. (Gilt also auch für Männer und nicht binäre Geschlechtsidentitäten). Deutlich weniger einfach ist allerdings herauszufinden, welche Fähigkeiten eigentlich die weiblichen sind. Und welche davon sind in uns individuell als Mensch angelegt? Wie erschließt und kultiviert man diese für sich selbst? Wie bringt man sie anschließend so ein, dass sie der eigenen Wirksamkeit und vor allem der Zielerreichung der Gruppe dienen?
Bevor es in der Sache weiter geht, sei betont, dass es sich lohnt, sich diesen Fragen zu widmen. Der positive Effekt des „Führen im Einklang mit den inneren Fähigkeiten“ ist, dass wir keinen Energieverlust erleben. Wenn wir unter Nutzung unserer natürlichen Ressourcen und Fähigkeiten entscheiden und handeln, kommen wir dauerhaft leichter und nachhaltiger ans Ziel. Und noch etwas sei vorweggenommen: Zu weiblichen Ressourcen zähle ich persönlich unter anderem all die Fähigkeiten, die Frauen einbringen, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern: Leben in sich tragen, es wachsen lassen und gebären können.
Das mag schrecklich altbacken klingen, aber stellen wir es uns einfach mal als eine schöne Metapher im Kontext von Innovation vor. Schon ist sie hochmodern, die weibliche Fähigkeit, etwas Neues in die Welt zu bringen. Welche Eigenschaften sind damit verbunden? Mir fallen zum Beispiel das Zulassen und Gelassenheit ein, Vertrauen, Intuition, Verbindung und Integration. Das sind für mich kultivierte weibliche Eigenschaften – die natürlich alle Menschen haben.
Gibt es dann auch Male Leadership?
Derzeit scheint es kaum notwendig, bewusst von „Male Leadership“ zu sprechen. „Führen“ an sich wird als eine männliche Fähigkeit verstanden. Dabei handelt es sich allerdings nur um ein antrainiertes Framing. Lösen wir uns für einen kurzen Moment mal davon, gilt wohl: ja, immer da, wo man mit seinen männlichen Fähigkeiten zur Zielerreichung und eigenen Wirksamkeit nutzt, können wir genauso gut von Male Leadership sprechen. Wie schon zuvor muss allerdings auch hier sofort die Frage folgen: was sind männliche Eigenschaften? Auch das kann man übrigens im Zuge von Female Leadership mal durchdeklinieren.
Wie erschließt man sich Female Leadership?
Als Einstieg empfehle ich gerne die Berichte der Allbright Stiftung: hier wird klar, warum das Thema Frauen in Führung bei allem gesellschaftlichen Fortschritt noch unbedingt auf die Agenda gehört. Danach lohnt es sich diesen Ted Talk „The Science behind Female Leadership“ von Alexis Kanda anzuschauen. Um aber die Notwendigkeit von Female Leadership besser begreifen zu können, braucht es vor allem einen Blick in die Vergangenheit.
Wer verstehen will, wieso Führung als eine typisch männliche Eigenschaft wahrgenommen wird, liest Nicolo Macchiavellis „Il Principe“ aus dem 16. Jahrhundert. Das führt noch mal vor Augen, dass Führung im staatlichen und militärischen Sinne ein sehr altes Themenfeld ist. Im unternehmerischen Sinne wurde es erst in den letzten Jahrzehnten explizit Gegenstand von Forschung und Praxis: nachzulesen unter anderem in der Doktorarbeit „Führung und Emotionen“ von Fabian Urban.
Weiblichkeit ist ein ebenso uraltes Thema, das sich allerdings im Laufe der Menschheitsgeschichte sehr oft vor- und zurückentwickelt hat. Was unser heutiges Verständnis von Weiblichkeit angeht, empfehle ich für die Hartgesottenen eine Stippvisite bei Sigmund Freud zum Thema Weiblichkeit. Wer sich nun noch mit den sozialen Geschlechterrollen beschäftigen will, kann bei Judith Butler zum Thema Gender eine neue Perspektive gewinnen.
Aber auch zum Thema Female Leadership selbst gibt es natürlich diverse empirische Forschung. Gut zusammengetragen zum Beispiel von Alice H. Eagly und um die notwendigen kritischen Perspektiven ergänzt, zum Beispiel von Yvonne Due Billing. Einer der unerwartet aufschluss- und hilfreichsten Texte ist übrigens von Barbara L. Brooks „The Barriere within – relational aggression among women“. (Salopp ins Deutsche als „Stutenbissigkeit“ übersetzbar). Aufgenöffnend ist auch dieses Kurzvideo von Birgitte Biehl zum Thema Postfeminismus im Leadership. Und für einen versöhnlichen Abschluss schlage ich Michelle Millers TED Talk „We need to restore feminity“ vor.
Frau sein und Female Leadership
Aus meiner persönlichen Entwicklung heraus ist meine wärmste Empfehlung zum Thema Weiblichkeit das Buch „Roar“ von Stacy Sims. Stacy Sims ist promovierte Ernährungswissenschaftlerin und fast ihr ganzes bisheriges Leben lang Leistungssportlerin gewesen. Das hat ihr eine enge Beziehung zu ihrem (weiblichen) Körper beschert. Ihre Mission ist es, im Sport, in der Wissenschaft aber auch in den Köpfen aller Individuen das Bewusstsein dahingehend zu verändern: „women are not small men“. Besonders ihr Kapitel „Demystifying and Mastering your Menstrual Cycle“ wurde ein Gamechanger für mich. Es liefert eine spannende Beschreibung dessen, was im Zyklus im weiblichen Körper hormonell und physiologisch alles passiert.
Sie schreibt es aus der Sicht einer Leistungssportlerin. Doch auch wenn wir diese Brille nicht aufhaben sollten, ist der Text augenöffnend, weil er ein ur-weibliches Thema über seine Bedeutung für die Reproduktion hinaus in den Mittelpunkt rückt. Sie macht die Leserin neugierig darauf, ein oft lästiges Thema als eine Quelle für weibliche Leistungsfähigkeit zu begreifen.
Warum lohnt es sich, das Thema Female Leadership auf die Agenda zu setzen?
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland trotz vielfältiger Bemühungen in den Unternehmen immer noch nicht signifikant erhöht. Von nicht binäre Geschlechtsidentitäten, anderen Hautfarben und Kulturen, Migranten oder nicht-linearen Lebensläufen ganz zu schweigen.
Der Grund: In der modernen, männlich geprägten Arbeitswelt waren abweichende Führungsqualitäten (so auch die weiblichen) lange nicht gefragt. Und noch immer gelten die Stärken der Mehrheit als anschlussfähiger und wirksamer. Sie werden entsprechend in der Nachwuchsentwicklung gefordert und gefördert. Im Ergebnis sehen viele Frauen keinen Anreiz, nach Führungspositionen zu streben. Nicht zuletzt auch wegen der zu geringen Anzahl an aktiven Vorbildern, denen eine Kultivierung ihrer natürlichen weiblichen Stärken in ihrer Führungsrolle gelungen ist.
Während es vor allem vor dem Jahrtausendwechsel um eine soziale Wünschbarkeit von Diversität in Führungsrollen ging, gesellen sich spätestens mit der digitalen Transformation auch klare ökonomische Notwendigkeiten hinzu. Unternehmen realisieren, dass sie die zunehmende Komplexität des Wandels nur dann nachhaltig bewältigen können, wenn es zu einer Verknüpfung diverser, heterogener Qualitäten in der Führung kommt.
Es geht dabei nicht um die Erfindung eines völlig neuen Führungsstils. Es geht schlicht um die Entfaltung der in allen Menschen vorhandenen diversen und weiblichen Potentiale in der Führung. Eine Kombination mit den klassischen und männlichen Stärken, ermöglicht schließlich ein komplexes Repertoire an Führungsfähigkeiten und Verhaltensvariabilität. Das ist es schließlich, was Organisationen in Zeiten des permanenten Wandels brauchen.
Warum ist unsere Arbeitswelt überhaupt immer noch so stark männlich geprägt?
Dank „Normalarbeitsverhältnis“ – einer Idee aus der sozialen Marktwirtschaft der 80er-90er Jahre. Es beschreibt sozialversicherungspflichtige, auf Vollzeit angelegte, unbefristete Arbeitsverhältnisse von Männern als den Normalzustand. Da es aus der Wissenschaft kommt, kann das Normalarbeitsverhältnis einerseits rein deskriptiv verstanden werden: Es bezieht sich empirisch auf das mehrheitlich vorherrschende Beschäftigungsmuster. Andererseits wurde es aber auch als normatives Konzept verstanden: Es diente als Orientierungsgrundlage für rechtliche Vorschriften im Arbeits- und Sozialrecht, an der sich die Regulierung der Arbeitsbeziehungen lange orientierte.
Das Normalarbeitsverhältnis trug in dieser Doppelrolle somit wesentlich zum Erhalt des Status Quo am Arbeitsmarkt bei. Und damit nachhaltig zu einer recht einseitigen Verteilung von Lebenschancen.
Normalität erlangte es daher auch nur für die männliche Erwerbsbevölkerung: Vor allem Frauen und Migranten profitierten als Beschäftigte nicht von den sozialen Errungenschaften, die mit dem Normalarbeitsverhältnis einhergingen. Da es sich am vorherrschenden Ideal der Nachkriegszeit des männlichen Ernährers orientierte, festigte es für unnötig lange Zeit traditionellen Geschlechterbeziehungen.
Elternzeit als historischer Stolperstein
Dazu kommt, dass man mit dem 1992 eingeführten „Erziehungsurlaub“ der weiblichen Erwerbsbevölkerung einen Bärendienst erwies. Dazu muss man kurz ausholen: Erst seit 1979 gibt es überhaupt so etwas wie Elternzeit in Deutschland. Diese war zunächst auf Mütter beschränkt und bedeutete 6 Monate Kündigungsschutz bei Arbeitsplatzgarantie. Dieser Mutterschaftsurlaub erlaubte Frauen den einfachen Wiedereinstieg in das Berufsleben. Erst als 1986 der Mutterschaftsurlaub vom Erziehungsurlaub abgelöst wurde, konnten erstmals auch Väter für 10 Monate im Beruf pausieren.
1992 wurde schließlich der Erziehungsurlaub eingeführt, der für ganze 3 Jahre in Anspruch genommen werden konnte. Als finanzielle Entlastung gab es das einkommensunabhängige Erziehungsgeld in Höhe von 600 DM. Mit dem Erziehungsurlaub ging ein dreijähriger Kündigungsschutz einher, mit einer fatalen Konsequenz für den Arbeitsmarkt: er führte zu der besorgten Auffassung vieler Arbeitgeber, ihre angehende weibliche Führungskraft für einen sehr langen Zeitraum verlieren zu können. So nahm das Interesse, junge Frauen „im gebärfähigen Alter“ zu fördern und in Führung zu befördern, spätestens an der Stelle stark ab.
Bis heute ist dieser Gedanke noch verankert in den Köpfen vieler Unternehmer und Personaler, obwohl dieser Kündigungsschutz 15 Jahre später wieder abgeschafft wurde. Erst mit der Anpassung der Elternzeit und dem Elterngeld von 2007 erhalten Eltern nun ein einkommensabhängiges Elterngeld für 12 Monate wenn nur ein Elternteil die Elternzeit in Anspruch nimmt. Und 14 Monate, wenn beide Partner sich beteiligen.
Im internationalen Vergleich
Wenn wir also die Barriere in unseren Köpfen für den nur sehr zähen Wandel verantwortlich machen, sollten wir nicht vergessen, dass die Gesetzgebung in Kombination mit der soziokulturellen Historie eines Landes diese Barriere mit aufgebaut haben. Das alles schlägt sich übrigens wahrscheinlich auch auf die Geburtenrate nieder. Schauen wir uns die Fertilitätsrate vs. der Anzahl von Frauen in Führungspositionen und die Gestaltung der Elternzeit an: da steht Deutschland mit 1,57 Kinder pro Frau mit weiblichen Führungsrate von 23% gegenüber bei 12-14 Monaten Elternzeit ziemlich abgeschlagen da.
Dass aber die lange Elternzeit allein nicht das Problem sein kann, zeigt der Blick nach Schweden: mit seiner Geburtsrate von 1,85 Kinder pro Frau, einer weiblichen Führungsrate von 39% bei 16 Monaten Elternzeit mit 80% des Einkommens. Wohingegen zum Beispiel Frankreich mit 2,0 Kindern pro Frau, 32% Frauen in Führungspositionen bei nur 16 Wochen Mutterschutz. Ähnlich wie die USA mit einer Geburtenrate von 1,77, einer weiblichen Führungsrate von 40% bei nur 6 Wochen unbezahlten Mutterschutz. Es bleibt also komplex.
Female Leadership und Diversität
Nicht nur der Mangel an Frauen, Migranten oder nicht binären Geschlechtsidentitäten macht deutsche Unternehmensverstände zu einer recht eintönigen Angelegenheit. Da wäre auch noch das Problem des Thomas-Kreislaufs. Der Thomas-Kreislauf beschreibt, wie seit Jahrzehnten die deutschen Börsenunternehmen ihre Vorstände nach einem sehr eintönigen Muster rekrutiert haben. So ähneln sich die Mitglieder in Geschlecht, Alter, Herkunft und Ausbildung sehr sehr: mehrheitlich männliche westdeutsche Wirtschaftswissenschaftler im Alter von Mitte Fünfzig – namens Thomas, Michael oder Stefan.
Noch immer gibt es laut Allbright-Bericht von 2019 weniger Frauen (nämlich 66) als Thomasse, Michaels und Stephans (83) zusammengerechnet. Dank dieser Eintönigkeit haben nicht nur aufstrebende Frauen nach wie vor das Nachsehen, sondern auch viele Männer, die nicht in dieses sehr enge und erschreckend triviale Raster passen. Von der Akzeptanz der Diversität, die Frauen in die Vorstandsrunden bringen, werden in Zukunft also auch Männer profitieren, die nicht dem klassischen Profil entsprechen.
… auch gut für die Gleichstellung von Männern
Dazu kommt aber noch ein viel subtileres Problem, dass sich deutlich schwerer benennen lässt: Während Frauen bereits seit über 100 Jahren mit der Reformation weiblicher Identität konfrontiert sind, nicht binäre Geschlechtsidentitäten unser Denken rasant erweitern, hat eine vergleichbare Reflektion und Neudefinition der männlichen Rolle erst vor kurzem eingesetzt. Besonders die Väter der Männer, die heute in Führungspositionen sind, stammen oft noch aus der frühen Nachkriegsgeneration. Diese hat ihnen das Konzept einer sehr traditionellen Männlichkeit vorgelebt hat: den berufstätigen Vater als Familienoberhaupt und Ernährer der Familie, der selten zuhause war.
Viele männlich geprägte Unternehmen unterstützen bis heute Arbeitsverhältnisse mit ihren Mitarbeitern, die dem oben erwähnten Normalarbeitsverhältnis sehr ähnlich sind. Sie fördern nach wie vor selten aktive Ansätze, ihren männlichen Mitarbeitern alternative Arbeits- und damit Lebensmodelle aufzuzeigen. So verhindern sie aktiv nach den gleichen Work-Life-Balance-Möglichkeiten zu streben, wie sie viele weibliche Mitarbeiter längst wahrnehmen dürfen.
Der Mehrheit der Vollzeit-Erwerbstätigen Männer wird immer noch suggeriert, dass für ihre Funktion und Position mit Führungsverantwortung keine Möglichkeit für Teilzeit gibt. Hier können weibliche Teilzeit-Führungskräften, die nun vermehrt Erfolgsgeschichten schreiben, die Vorreiterrolle übernehmen, von der letztlich alle profitieren
Letzte Frage: Hilft eine Quote?
Wenn wir davon ausgehen, dass die Verteilung der relevanten Fähigkeiten völlig unabhängig vom Geschlecht ist und Frauen nicht nur die Hälfte der Bevölkerung darstellen, sondern auch etwas mehr als die Hälfte aller Universitätsabschlüsse in Deutschland, der Frauenanteil der Führungskräfte in vielen Berufen aber geringer ist als der Anteil der weiblichen Mitarbeiter der jeweiligen Branche, weist das wahrscheinlich auf ungenutztes wirtschaftliches Potenzial in der Gesellschaft hin. Die Idee der Quote basiert also auf dieser Idee: ein proportionaler Anteil von Frauen in Führungspositionen (und anderen unterrepräsentierten Gruppen) ist schlicht ökonomisch sinnvoll.
Um positive Diversitätseffekte zu erreichen, braucht es immer eine kritische Masse. Wissenschaftlich nachgewiesen verändern 30-40% Frauen eine Gruppe von Grund auf. Und verbessern die Zusammenarbeit und Produktivität. Unabhängig von der Gruppengröße gilt eine Anzahl von mindestens drei Frauen als zielführend. Erst dann ist keine Frau mehr verpflichtet, „alle Frauen“ zu vertreten, sondern kann für ihren persönlichen Blickwinkel stehen. Die weibliche Art zu entscheiden, zu handeln oder zu führen kann so schneller Teil der akzeptierten Norm werden. Eine Quotenregelung muss daher nicht für immer gelten. Sie kann als kurzfristiges Mittel eingesetzt werden, um strukturelle geschlechterdiskriminierende Mechanismen zu überwinden.
Fazit
Was sich zunehmend als hilfreich herauskristallisiert, um dem ökonomisch sinnvollen Thema Diversität und Frauen in Führung fokussierter über seine Hürden zu helfen: der Dreiklang aus einer Genderquote, Frauen, nicht-binäre Menschen ebenso wie Migranten in Führungspositionen und die Idee des Female Leadership. Das würde auch auf natürlichere Weise zu einer Integration von Gesetzgebungen, Unternehmenskulturen und unserem gesellschaftlichen Handeln führen.
Wer Quoten einführt, ermöglicht die notwendige kritische Masse für die gewünschten Diversitätseffekte. Wer Mitarbeiter, die nicht dem Mehrheitsbild entsprechen, in Führungspositionen befördert, ermöglicht das Entstehen von Vorbildern. Und wer weit über das Thema Quote insgesamt das Thema weibliche Führung für alle Führungskräfte zugänglich macht, entwickelt seine Kultur weiter. Das stellt seine Organisation zukunftsfähiger auf und ermöglicht so nachhaltig weitere notwendige positive Diversitätseffekte in unserer vernetzten Welt, die über den Genderaspekt hinaus gehen.
Über die Autorin
Lena Schiller ist Co-Director des House of Leadership, Politikwissenschaftlerin, Buchautorin, Coach und Ausdauersportlerin. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Themen New Work, Female Leadership und Digitale Transformation.
Artikel: A feminine principle in leadership Female Leadership Seminar: Female Leadership