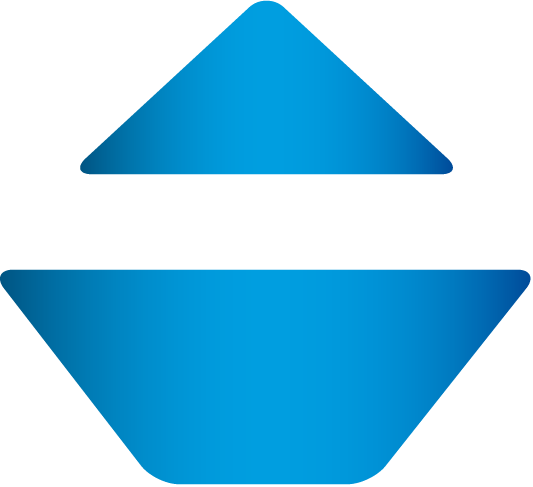New Work: New Self und New Leadership
Der technologische Fortschritt ist nicht der Auslöser der Transformation der Arbeit, sondern nur ihr Katalysator. Als ein lange zuvor in Gang gesetzter, tief in der Gesellschaft verankerter Wandel stellt New Work das Individuum mit seinen Motiven, Werten, Bedürfnissen und Haltungen in den Mittelpunkt. Neben einem besseren Verständnis von sozialer Interaktion und der Funktion dynamischer Systeme sind daher insbesondere das Ich und das Selbst zentrale Drehpunkte neuer Organisationsformen von Arbeit. Wollen Unternehmen New Work über die digitale Transformation hinaus gestalten, so müssen sie ihre Mitarbeiterentwicklung um den Aspekt der Selbstklärung ergänzen – nicht, weil die Arbeitskraft dann erst kompatibel wird, sondern ihre Arbeit.
Ein Blick zurück
Je weiter wir im Diskurs um die Zukunft der Arbeit fortschreiten, um so interessanter wird ein Blick zurück auf die Quellen des New-Work-Stroms. In seinem Werk „Neue Arbeit, neue Kultur“ beschreibt der Ur-Vater der New Work Idee, der deutsch-amerikanische Arbeitsphilosoph Frithjof H. Bergmann, Arbeit als eine milde Krankheit. Wir sterben zwar nicht an ihr, aber wir gesunden auch nicht an ihr. Die Ursache liegt für ihn darin: in der klassischen Lohnarbeit ist die zu erledigende Aufgabe das Ziel und der Mensch nutzt sich selbst dafür als Werkzeug und betreibt somit Selbstausbeutung.
Mit der „Neuen Arbeit“ hingegen soll also unbedingt danach gestrebt werden, diesen Zustand umzukehren: Nicht wir sollten der Arbeit dienen, sondern die Arbeit sollte uns dienen. Wenn die Arbeit dem Mensch Kraft und Energie verleiht, so Bergmann, kann sie ihn bei seiner Entwicklung unterstützen, ein lebendiger, vollständiger Mensch zu werden. Dabei reicht es nicht, die klassische Lohnarbeit einfach nur angenehmer zu gestalten. Sie muss in ihrer Ausgestaltung eine Erlösung des Einzelnen sein, aber auch der Gesellschaft. Sie muss es sich zur Aufgabe machen, verfügbare Jobs gerechter zu verteilen: durch Teilzeitarbeit. Die dadurch freiwerdende Zeit könnte der Einzelne zum einen für sein „Calling“ nutzen: für das, was er „wirklich, wirklich“ will. Zum anderen würde er sie für „High-Tech Selbstversorgung“ nutzen, die er zum Beispiel gemeinschaftsbasiert ausübt. Ein Idealzustand, wie ihn nur ein Philosoph beschreiben kann.
Die Rolle des Kapitalismus für New Work
Für den Real-Zustand lohnt sich ein Blick in das epische Werk „Der neue Geist des Kapitalismus“ der französischen Soziologen Eve Chiapello und Luc Boltanski. Auch sie beschreiben die kapitalistische Organisation von Arbeit als ein absurdes System. Der zugrundeliegende Prozess der stetigen Akkumulation von Kapital zwingt nicht nur diejenigen, die ihr Kapital einspeisen, in einer Atmosphäre starker Konkurrenz und Unsicherheit. Sie müssen daraufhin den einmal begonnenen Kreislauf ohne Unterlass fortführen. Er erfordert zugleich, dass die Mehrheit der Bevölkerung, nämlich die, die kein Kapital haben, sich in abhängige Lohnarbeit begeben. Dort sind sie unfrei und erlangen auch keinen Besitz an den Früchten ihrer Arbeit. Augenscheinlich gibt es daher eigentlich keine naheliegende Rechtfertigung für die freiwillige und friedliche Einbindung der Menschen in den Kapitalismus.
Doch ohne eine gesellschaftliche und persönliche Motivation des Einzelnen seine Arbeitskraft einzubringen, würde der Kapitalismus nicht mehr existieren. Die Autoren arbeiten heraus, dass ein essentieller Aspekt für die selbstmotivierte Einbindung daher die Vorstellung aller Beteiligten sein muss, dass sie hier ihren Handlungen einen „Sinn“ geben können. Dieser Sinn geht weit über die Idee der Profitsteigerung hinaus. Der konkrete Anreiz des sinnsuchenden Einzelnen hängt davon ab, für welche Leistung die Gesellschaft ihre Anerkennung vergibt. Im „neuen Geist des Kapitalismus“ – gemeint ist der Netzwerkkapitalismus der letzten 50 Jahre, der von der Vernetzung der Unternehmen sowie der Globalisierung der Finanzen geprägt ist –, erlangt das Individuum gesellschaftliche Anerkennung für seinen Beitrag zu Innovation, Kreativität und ständigem Wandel. Kurz: Belohnt wird die Fähigkeit immer neue Netzwerke zu etablieren.
Arbeit menschlicher machen
Der Netzwerkkapitalismus hatte den zuvor erfolgreichen Konzernkapitalismus abgelöst. Begleitet wurde er dabei durch zwei Formen der Gesellschaftskritik: Sozialkritik und Künstlerkritik. Die Sozialkritik wurde von den Organisationen der Arbeiterbewegung getragen. Durch die Neustrukturierungen der Arbeitswelt in den 1970er- und 1980er-Jahren gelang es, diese Kritik weitestgehend gegenstandslos zu machen. Daraufhin gewann die Künstlerkritik an Relevanz, deren Träger vor allem Intellektuelle der 70er Jahre waren. Ihre Kritik richtete sich gegen Normierungstendenzen, Entfremdung und kühle Bilanzierung, die die Entfaltung, Kreativität, Individualität des Einzelnen und die Vielfältigkeit in der Gesellschaft stark einschränken würden.
Das eigenverantwortliche, sich selbst verwirklichende Individuum in den Mittelpunkt rückend, erwirkte die Künstlerkritik das Aufkommen neuer Arbeitsstrukturen. Diese waren geprägt von Mechanismen wie Mitsprache, Selbstorganisation und Vertrauen statt Kontrolle. Die Künstlerkritik der 70er Jahre wurde so zur Wiege unserer heutigen New-Work-Bewegung und ihrer Organisationsformen. Sie zeichnet sich bis heute durch die Ablehnung hierarchischer Unterordnung und die Aufwertung von Eigeninitiative, Risikobereitschaft und Selbstorganisation aus. Sie ermöglicht die Identifikation der Individuen mit ihrer projektförmigen Arbeit in der vernetzungsorientierten Welt.
Wir als Unternehmer unserer eigenen Arbeitskraft
Was vorher nur für Selbständige galt, findet man nun vermehrt auch bei Festangestellten. Die deutschen Soziologen Hans J. Pongratz und Gert-Günter Voß beschreiben diese Entwicklung in ihrem Aufsatz aus den 00er Jahren „Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen“. Die bisher vorherrschende Form des verberuflichten Arbeitnehmers wird in vielen Arbeitsbereichen abgelöst durch einen neuen strukturellen Typus: den Arbeitskraftunternehmer. Dessen Kennzeichen sind eine verstärkte Ökonomisierung der eigenen Arbeitsfähigkeiten und Leistung sowie eine Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung: mehr Selbstkontrolle, Selbstmanagement und Selbstführung.
Spätestens seit der Allgegenwärtigkeit des Internets zeigt sich, dass dies nicht eine Forderung an sondern vor allem von Arbeitnehmern ist. Das zeigt sich Paradebeispiel-haft in der Open-Source-Bewegung: eine ökonomisch ungewöhnliche Produktions- und Konsumweise, die sich für beliebig viele Mitarbeiter öffnet und auch nichtzahlende Konsumenten bedient. Sie widerspricht damit zwei wesentlichen kapitalistischen Prinzipien: der von Managern organisierten Arbeit und dem Handel mit eigentumsgesicherten Gütern. Diesem Rätsel geht der deutsche Ökonom Birger P. Priddat in „Open Source als Produktion von Transformationsgütern“ nach. Er sieht die Existenzberechtigung von Open-Source-Projekten in ihrer Transformationsgütereigenschaft: sie verändern den Akteur durch ihre selbstorganisierten Netzwerke, ihren Ausbildungsmechanismus von individuellem Humankapital, ihre soziale Rollenstruktur und ihre hybriden Prinzipien kooperativen Wettbewerbs und produktiven Konsums.
Teil eines großen Ganzen sein
Die wirtschaftlichen Potenziale ergänzen die beiden Open-Innovation-Forscher Hind Benbya und Nassim Belbaly in ihrem Aufsatz „Successful OSS Project Design and Implementation“ um die ideelle Motivation des Einzelnen. Die Open-Source Bewegung bildet einen wichtigen Resonanzraum: jeder Teilnehmer darf für vorhandene Kompetenzen, die er in das Projekt zielführend einbringt, mit Anerkennung von Gleichgesinnten rechnen. Neben der Möglichkeit zu einem großen Ganzen beizutragen, kann er neue Fähigkeiten einüben und die eigene Kreativität selbstgewählt ausleben.
Dürfen wir also New Work als das Resultat einer stetigen Herausschälung der Selbstbestimmung und der Selbstwahrnehmung von Individuen begreifen? Zumindest scheint sie selbstgewählt aus dem Menschen hervorgegangen. Und eben nicht, wie oft argumentiert, allein die Folge eines ökonomischen Selbstoptimierungs- und Selbstausbeutungszwangs des digitalen Zeitalters zu sein.
Die Entwicklung wirkt reziprok: Die gesellschaftlich angestoßene, wirtschaftliche Weiterentwicklung von Arbeit entspringt einerseits dem individuellen Grundbedürfnis nach Sinnstiftung und Wirksamkeit. Sie ermöglicht andererseits den ersehnten Wachstumsprozess des Einzelnen. Das Konstrukt „ICH“ und das damit einhergehende Bündel von individuellen Ressourcen, Kompetenzen und Qualitäten wird erst durch seine Einbindung in Arbeitsverhältnisse umfänglich angeleuchtet. So wird es schließlich bewusst von ihm in die gesellschaftliche Grundordnung sowie den unternehmerischen Wertschöpfungsprozess eingebettet.
Die Suche nach Sinn
Dabei handelt es sich übrigens keineswegs um ein Phänomen des Wohlstands und der Friedenszeiten. Der Bedarf nach Antworten auf schwelende Fragen der individuellen Existenz, des gelingenden Miteinanders und der übergeordneten Sinnhaftigkeit sind übersituativ stabil: Selbst während globaler Krisen, wo der Wunsch nach Selbstverwirklichung vermeintlich vom Wunsch nach blankem Überleben abgelöst wird, wurden populärwissenschaftliche Veröffentlichungen und Ratgeber zur Selbstfindung und zum Selbstvertrauen zu Bestsellern. Wie in den düsteren 1940er Jahren die Bücher „Wie man Freunde gewinnt“ oder „Sorge Dich nicht – lebe!“ des amerikanischen Kommunikationstrainers Dale Carnegie.
Während der Strom der sogenannten Zweckoptimismus-Literatur lange eine stetige Nachfrage verzeichnete und in der soziologischen und philosophischen Auseinandersetzung die Idee des Sinnsuchers bereits Gegenstand differenzierter Forschungsdirektiven war, ließ es sich in der Betrachtung traditioneller Schulen der Ökonomie lange nur sehr vereinzelt wiederfinden. Viele Facetten des individuellen Seins blieben hier unbetrachtet oder wurden gar bewusst ausgeklammert. Das vergrößerte den Graben zwischen der Wissenschaft und der unternehmerischen Praxis weiter.
Emotionen als Treiber für New Work
Schließlich wagte der amerikanische Psychologe und Wissenschaftsjournalist Daniel Goleman in den 90er Jahren mit seinem Buch „Emotionale Intelligenz“ einen ersten vorsichtigen Vorstoß. Er scheiterte jedoch an der wissenschaftlichen Ungenauigkeit und am Silodenken der Wissenschaftsdisziplinen. Dabei hatte er einen wesentlichen Schlüssel aufgezeigt, der das menschliche Denken und Handeln und vor allem das soziale Miteinander aufschlüsselt: Emotionales Erleben. Dank seiner Auseinandersetzung mit Emotionen, die oft heute noch in der Ökonomie als irrelevant gelten oder gar als Störvariablen betrachtet werden, brachte Goleman das versteinerte Bild des „Homo Oeconomicus“ langsam ins Wanken. Emotionen mauserten sich zunehmend zu einer zentralen Stellgröße innerhalb der individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Zu Recht: jedes emotionale Erleben zeigt uns Menschen auf, welche Dinge von signifikanter Bedeutung für unsere individuelle Existenz sind. Wiederholtes emotionales Erleben erzeugt schließlich Sichtweisen, die zu Einstellungen und Haltungen werden. Diese prägen unseren individuellen Lebensentwurf grundlegend (Urban, 2008). Emotionales Erleben bildet eine starke Handlungsgrundlage von Individuen, und trägt auf diese Weise entscheidend zur Beantwortung der Frage bei: aus welchem Beweggrund heraus tun wir Menschen Dinge? Darunter auch die Frage, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe George Loewenstein holte zur Jahrtausendwende mit seinem Artikel „Emotions in Economic Theory and Economic Behavior“ im American Economic Review dann die Thematik aus der populärwissenschaftlichen Ecke endlich auf die große wirtschaftswissenschaftliche Bühne. Fortan wurde dem emotionalen Erleben als erklärende, aber auch gestaltende und gestaltbare Variable in unserer Arbeitswelt eine Bedeutung zugeschrieben.
Leadership by Personality
Ihren Einfluss auf die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen greift auch der deutsche Pädagoge Rolf Arnold in seinem Managementratgeber „Leadership by Personality“ auf. Er zeigt die Bedeutung der Phänomene Selbstarchäologie und Selbstklärung für gelingende Führung aufzeigt – als den entscheidenden Zugang zu emotionalen Kapazitäten (Arnold, 2014). Diese Auseinandersetzung mit sich selbst, das Erkennen von intrapersonalen Wirkmechanismen, das Verstehen und Kultivieren emotionaler Kausalbeziehungen, die sinnstiftende Bahnung individueller Bedürfnis- und Motivsysteme ist (Selbst-)Aufklärung im Kantschen Sinne: das Individuum sucht sich selbst, klärt sich selbst und eröffnet damit neue Wirkräume für sich und andere.
Das lässt sich als esoterische Bewusstseinserweiterung abtun. Ökonomisch betrachtet ist es Spezialisierung gemäß komparativer Kostenvorteile. Die Zukunft der Arbeit entsteht in Organisationen also nicht bei der Einführung neuer Technologien, sondern in der Organisationsentwicklung als Ganzes: das Angebot zur Selbstklärung eines jeden Einzelnen wird Unternehmen zukunftsfähig machen. Nicht, weil sich dann der Mitarbeiter besser an seine Arbeit anpasst, sondern seine Arbeit an ihn.
Dieser Artikel wird in gekürzter Form im Sammelband „Zukunft der Arbeit – ein Panorama aus 100+ Federn“, herausgegeben von Jens Nachtwei, im September 2020 erscheinen und verbindet die thematischen Fundamente von Dr. Fabian Urban (Führung, Emotionen & Identität) und Lena Schiller (New Work & Zukunft der Arbeit).
Literatur
- Arnold, Rolf: Leadership by Personality. Von der emotionalen zur spirituellen Führung – Ein Dialog. Springer Gabler, Wiesbaden 2014
- Benbya, Hind; Belbaly, Nassim: Successful OSS Project Design and Implementation. Farnham, Gower Publishing 2011
- Bergmann, Frithjof H.: Neue Arbeit, neue Kultur. Arbor Verlag, 2004
- Boltanski, Luc; Chiapello, Ève: Der neue Geist des Kapitalismus. Herbert von Halem Verlag, 2006
- Giesa, Christoph; Schiller, Lena: New Business Order – Wie Startups Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Hanser, München 2014
- Pongratz, Hans J.; Voß, Gert-Günter: Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. edition sigma, Berlin 2003
- Priddat, Birger: Open Source als Produktion von Transformationsgütern. In: „Organisation als Kooperation“, Springer Verlag, 2010
- Urban, Fabian: Emotionen und Führung. Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2008
Über die Autoren
Lena Schiller ist Co-Director des House of Leadership, Politikwissenschaftlerin, Buchautorin, Coach und Ausdauersportlerin. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Themen New Work, Female Leadership und Digitale Transformation.
Fabian Urban ist Co-Director des House of Leadership, Langdistanz-Triathlet, Verhaltenswissenschaftler und promovierter Volkswirtschaftler.
Zu seinen Themen gehören Führung, Emotionen und Potentialentfaltung.
Video: Interaktiver Vortrag „New Work“
Interaktive Seminare virtuell ausrichten