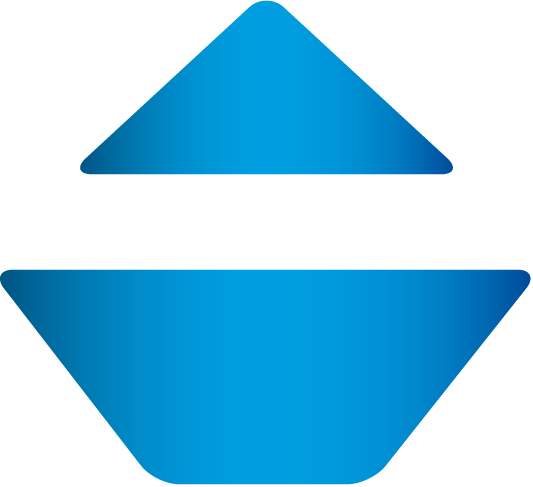Liminalität: Leadership in Phasen der Orientierungslosigkeit
In der Anthropologie beschreibt Liminalität (vom lateinischen Wort limen = die Schwelle) die Qualität einer Übergangsphase. Diese zeichnet sich durch Mehrdeutigkeit, Unklarheit oder Orientierungslosigkeit aus wenn wir an einer Schwelle im Leben stehen, wo wir unseren alten Status nicht mehr und zugleich unseren neuen Status noch nicht innehaben. Das Konzept wurde zunächst und sehr ausführlich am Beispiel von Ritualen von Urvölkern erforscht wurde. Man denke an Initiationsriten vom Jungen zum Mann und Mädchen zur Frau. Später wurde es auch aufschlussreich auf moderne westliche Gesellschaften übertragen: Hochzeiten, Einschulungen, Abitur, Elternwerden, Pensionierung aber auch der Geburtstag zur Volljährigkeit und dergleichen. Die wohl weltweit universalste liminale Erfahrung ist die Pubertät. Auch wenn sie in unseren Breitengraden nicht (mehr) von Ritualen begleitet wird.
Liminalität – aus der Ritualforschung entlehnt
Der Begriff der Liminalität wurde erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ethnologen Arnold van Gennep entwickelt und später von Victor W. Turner aufgegriffen. Arnold van Gennep war ein deutsch-französischer Ethnologe im 20. Jhd, der heute vor allem durch seine Forschung über Übergangsritualen bekannt ist. Der Schotte Victor Witter Turner war ebenfalls Ethnologe und erforschte unter anderem die Bedeutung von Pilgerreisen in Mexiko, Brasilien und Irland.
Anknüpfend an diese beiden Forscher wurde Verwendung des Begriffs Liminalität in der Wissenschaft zunehmend ausgeweitet, um in im Zusammenhang mit politischem und kulturellem Wandel nutzen zu können. In gesellschaftlichen Schwellenzeiten – zu der vielleicht auch die Pandemie gezählt werden kann – werden soziale Ordnungen ebenso vorübergehend aufgelöst und neu geordnet wie im individuellen Kontext. Die Fortsetzung von Traditionen wird ungewiss und als selbstverständlich angenommene zukünftige Ereignisse können in Frage gestellt werden. Diese Auflösung der Ordnung während dieser Schwellenphasen wirkt destruktiv und konstruktiv zugleich: sie löst Bestehendes zwar auf, kreiert aber damit eine fließende, formbare Situation, die die Etablierung neuer Ordnungen, Institutionen und Bräuche ermöglicht.
Der Mehrwert in heutigen Zeiten
Um zu verstehen, welchen Mehrwert dieses Konzept für unsere heutigen Zeiten und vor allem für das Thema Selbstführung hat, lohnt ein Blick auf Arnold van Genneps modellhafte Unterteilung klassischer Übergangsrituale in drei Phasen:
- Phase: Trennungsritus. Sie geht der Liminalität voraus und beinhaltet einen metaphorischen „Tod“, da der „Übergehende“ gezwungen ist, etwas hinter sich zu lassen. Wir brechen mit früheren sozialen Verbindungen, Praktiken und Routinen. (Übertrage das einfach mal auf deinen Schulabschluss oder einen Karrieresprung im Unternehmen: wovon musstest du dich dort verabschieden und was „starb“ in dem Moment sogar?)
- Phase: Übergangsritus. Dies ist der Teil des Prozesses, den Liminalität eigentlich beschreiben will. Es ist die „Nicht-mehr-und-Noch-nicht“-Phase. In klassischen Ritualen sind zwei Merkmale für sie wesentlich: Sie folgt einem streng vorgeschriebenen Ablauf, bei dem jeder weiß, was und wie es zu tun ist. Sie muss unter der Autorität eines „Zeremonienmeisters“ erfolgen. (Übertrage auch dies noch einmal auf deinen Schulabschluss, die Abschlussklausuren, Abschlussfeier etc.)
- Phase: Inkorporationsritus. Dies ist die postliminale Phase, wenn der Übergehende mit seiner neuen Identität als neuer, veränderter, gewachsener Mensch in die Gesellschaft integriert wird. (Wie war das nach deinem Schlussabschluss oder beim Karrieresprung?)
Diese Phasen sind unbedingt als theoretisches Modell zu betrachten. Das heißt: sie finden in der Realität und auch in unserem emotionalen Wahrnehmen nie klar abgegrenzt und zeitlich nacheinander statt, sondern vermischen sich. Und sie können mehrfach wiederholt werden, bis wir aus ihnen irgendwann heraustreten.
Liminalität ohne Rituale
Das Besondere an klassischen Übergangsritualen, wie die Ethnologen sie meinen, ist, dass sie vorab beschrieben oder sogar festgeschrieben sind. Damit sind sie allgemeinhin bekannt in ihrem Ablauf. Das Woher steht dann ebenso wie das Wohin bereits fest. Aber das macht sie für den Teilnehmenden während seines Durchlaufes emotional allerdings nicht leichter.
Denke zum Beispiel an die Übergangsphase „Studienbeginn“: Einerseits begleitet von klaren Schritten im Außen wie Einschreibung und Ersti-Woche, ist diese Phase aber andererseits auch durch große innere Unsicherheit geprägt: Wohnungssuche, das Suchen neuer Freunde und dem orientierungslosen Herumlaufen auf dem Campus, auf der Suche nach dem Studiensekretariat. Und das besorgte Herumblättern in der Studienordnung, um das Rätsel eines möglichst regelkonformen Studiums zu lösen. Diese prägenden inneren Erfahrungen des Schwellendaseins, des Loslassen, Suchens, Unsicherseins und Findens bereiten uns aber darauf vor, anschliessend selbstsicher und gefestigt diese neue Rolle (zum Beispiel des Studierenden) einzunehmen.
Das Konzept der Liminalität wird mittlerweile auch auf ganze Gesellschaften angewendet, die sich in einer Ordnungskrise befinden. Es lässt sich ebenso auf die Zeiten der Weltkriege wie auch die Digitalisierung im letzten Jahrzehnt beziehen. Oder eben auf die globale Pandemie.
Die Herausforderung moderner Liminalität
Ein Problem der Liminalität in gesellschaftlichem Wandel besteht aber darin, dass es leider keinen eindeutigen Weg hinein und vor allem auch keinen vorgegebenen Ausweg gibt. In klassischen Übergangsritualen (wie der Initiationsritus bei Urvölkern) sind sich die Teilnehmenden selbst wahrscheinlich des liminalen Zustands bewusst. Sie wissen, dass sie ihn früher oder später verlassen werden. Sie haben wahrscheinlich sogar einen geübten ‚Zeremonienmeister‘, der sie durch die verschiedenen Schritte führt.
In Schwellenphasen, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen, ist der Ablauf ebenso wie die Zukunft für einige Zeit hingegen völlig ungewiss. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dies Fluch und Segen zugleich ist: Einerseits besteht die Gefahr, dass sich „selbsternannte Zeremonienmeister“ in gesellschaftliche Führungspositionen begeben und die momentane Orientierungslosigkeit für ihre Zwecke nutzen. Man denke an die Weimarer Republik. Andererseits ermöglichen diese Schwellenphasen ein großes Maß an Kreativität im Gestalten wahrlich neuer Strukturen des Miteinanders, neue Institutionen und Routinen. Mman denke an die 68er.
Ganz ähnlich verhält es sich mit vielen unsicheren Übergängen in unserem modernen Leben. Doch diese werden meist nicht mehr von feierlichen Ritualen begleitet sondern von Schweigen und Unsichtbarkeit: Phasen der Arbeitslosigkeit, die Wechseljahre oder der Weg ins Altersheim. Könnte hier das Wissen um das Konzept der Liminalität individuell von Nutzen sein?
Liminalität ist allgegenwärtig
Das Konzept der Liminalität findet sich übrigens in unserem Alltag überall wieder: Liminalität lässt sich auf Räume beziehen – Treppenhäuser oder Flugzeuge gehören dazu. Auch Existenzen können als liminal bezeichnet werden: Arbeitslose oder Reisende zum Beispiel, Flüchtlinge ebenso wie Angeklagte vor Gericht oder transgeschlechtliche Menschen, die sich in einer Phase der Geschlechtsanpassung befinden. Eine besonders eindrucksvolle Geschichte der Liminalität erzählt der Film „Terminal“ mit Tom Hanks . Als Bürger des sich auflösenden Staates Krakosien sitzt er am Flughafen in New York fest. Ohne Pass eines anerkannten Staates kann er weder zurück in die verschwundene Heimat, noch in die USA einreisen.
Für Führung und Selbstführung bietet das Konzept der Liminalität verschiedene hilfreiche Ansätze an. Hier lässt sich zum einen die Rolle des Zeremonienmeisters (im wörtlichen ebenso wie im übertragenen Sinne) betonen: gibt es sowas in den großen und kleinen Übergängen unseres Lebens oder bei Rollenwechseln innerhalb des Jobs? Inwieweit sind wir es selbst? Und auch der Blick auf die drei Phasen (Trennung, Übergang, Inkorporation) eines Rituals ermöglicht uns das Verstehen, aber auch das bewusste Gestalten von vor uns liegenden Übergängen.
Besonders wertvoll aber ist am Konzept der Liminalität, dass es einer wichtigen Phase von Veränderungen einen Namen und damit besondere Aufmerksamkeit gibt, durch die wir bisher vorzugsweise mit „Luftanhalten, Augen zu und durch“ durchgetaucht sind: die Phase der zwischenzeitlichen Orientierungslosigkeit, wenn sich etwas in unserem Leben und unsere Rolle grundlegend verändert.
Können wir dieser Phase künftig eine andere Qualität geben?
Zusätzliche Literatur
- Victor W. Turner: Liminalität und Communitas. In: Andréa Belliger, David J. Krieger (Hrsg.): Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch. Westdeutscher Verlag, Opladen 1998
Über die Autorin
Lena Schiller ist Politikwissenschaftlerin, Buchautorin und Coach. Sie hat den 1. Dan (Aikido) und 25 Jahren lang drei verschiedene Aikido-Arten trainiert. Sie ist Co-Director des House of Leadership und beschäftigt sich mit Transformation, Embodiment und Leadership.