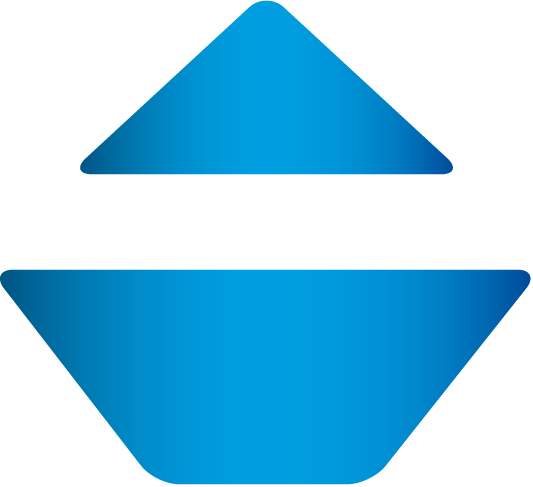Embodiment: Self-Leadership und unser Körper
Im Laufe unseres Lebens machen wir eine riesige Bandbreite an Erfahrungen, von denen wir lernen. Wir speichern diese auf sehr komplexe Art ab, um auf das Gelernte jederzeit – und vor allem im Notfall blitzschnell – zugreifen zu können. Das geschieht, indem wir neben dem eigentlichen Geschehnis auch abspeichern, welche Konsequenz es für uns körperlich oder im sozialen Miteinander hatte. Dazu ist es wichtig, dass wir auch abspeichern, was wir emotional erlebt haben. All das ist so eng miteinander verbunden, dass es sich im Nachhinein auch nicht mehr trennen lässt. Die Verkörperung von Erinnerungen und Erlebnissen wird Embodiment genannt.
Unser Körper als Erfahrungsspeicher
Wenn wir uns an eine wichtige Situation aus unserer Vergangenheit erinnern, können wir uns oft sehr lebendig auch an die Freude, Verärgerung oder Blamage dieser Erfahrung erinnern. Und nicht selten erleben wir auch eine Reihe von realen Empfindungen und Reaktionen von damals in unserem Körper wieder.
Probier es selbst kurz aus: wann hast du dich mal sehr blamiert? Vielleicht so sehr, dass es dir auch heute noch unangenehm ist? Denk einmal an diese Situation zurück: wo warst du, wer war da, was ist passiert? Wahrscheinlich dauert es jetzt nicht lange, bis sich auch im Körper die Scham von damals wieder bemerkbar macht. Vielleicht wird dein Gesicht gerade warm. Die oberen Rückenmuskeln oder Waden erschlaffen (= das Gefühl im Boden versinken zu wollen). Deine Kehle zieht sich etwas zu (= der Klos im Hals). Oder der Puls wird intensiver.
Was du jetzt spürst, ist deine Verkörperung von wichtigen Erlebnissen und Erfahrungen. Wenn wir heute ganz real wieder in eine Situation kommen, die recht nah an eine bereits gemachte, ältere Erfahrung rankommt, kommen auch die körperliche Empfindung und das emotionale Erleben aus der damaligen Situation wieder auf. Das Spannende daran ist, dass diese abgespeicherte Körperempfindungen und die dazugehörige Emotion dann blitzschnell unser Handeln leiten. Das passiert meist lange bevor wir uns überhaupt kognitiv bewusst geworden sind, was gerade passiert.
Vom Körper geleitet werden
Je öfter wir bestimmte Erfahrungen machen, um so stärker ist dieses Phänomen des inneren „Geleitet-werdens“. Und das ist gut so: wir ducken uns blitzschnell schützend weg, wenn etwas überraschend auf uns zugeflogen kommt. Oder wir spüren, dass gleich ein Streit ausbricht und ziehen uns rechtzeitig körperlich und mental zurück. Denke mal an all die Automatismen deines Lebens: wenn du – zum Glück – bereits richtig reagierst, bevor du eine Situation vollends erfassen konntest. Das hat viele Vorteile, besonders in Notsituationen. Wenn es schnell gehen muss, erspart uns der Automatismus den zeitraubenden Prozess einer langwierigen Erfassung der Situation. Aber vor allem im Alltag spart das Gehirn gerne die Energie. Anstatt immer alles erneut zu durchdenken, greift es gerne auf bewährte Handlungsmuster zurück.
Das hat natürlich auch Nachteile: nicht alle unserer automatischen Handlungsmuster sind immer gewünscht und angebracht. Zum Beispiel wenn wir viel zu früh innerlich hochfahren, weil unser Körper meint zu verspüren, dass eine Situation gleich im Streit enden könnte. Oder wenn sich dauernd eine Traurigkeit wie ein schwerer Mantel über uns legt, nur weil der Körper bereits das Muster von Hilflosigkeit aktiviert. Wenn wir reagieren, lange bevor die Situation sich entfaltet hat, nur weil es in der Vergangenheit öfter mal dazu kam.
Embodiment: unser Bewusstsein braucht den Körper
Diese sehr komplex ablaufenden Muster beschreiben Wissenschaftler als Embodiment. Der Begriff kommt aus der Kognitionswissenschaft und bezieht sich auf die Erkenntnis, dass unser Bewusstsein den Körper benötigt. Das hier das Wort Body besonders betont wird, mag daran liegen, dass man lange in den Wissenschaften den Körper außen vor ließ, wenn man kognitive Prozessen erforschte. Insofern ist Embodiment immer auch ein Plädoyer für das Konzept Soma: die Gesamtheit des lebenden Wesens, seinen Körper und seinen Geist und seine Seele als Einheit begreifend. Wir wollen im Folgenden einen kleinen Einblick geben, wie das Intelligenzsystem Körper funktioniert. Und wie wertvoll es für uns Menschen in der Selbstführung ist.
Wir wollen hier zwei Vor- und Mitdenker von Embodiment zu Wort kommen lassen: den bekannten deutschen Neurowissenschaftler Gerald Hüther und die Therapeutin und Gründerin des Zürcher Ressourcenmodells Maja Storch. Beide haben u.a. gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern das Buch „Embodiment – Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen“ veröffentlicht (Leseempfehlung!). Außerdem wollen wir euch ein paar Erkenntnisse des portugiesischen Neurowissenschaftlers António Damásio vorstellen, bekannt durch seine Arbeiten zur Bewusstseinsforschung.
Unser Körper als Führungskraft
Wie klug und schnell der Körper beim Lernen, Entscheiden und Handlungsleiten ist, macht das folgende Beispiel deutlich: In einem Experiment ließ der Bewusstseinsforscher Antonio Damasio die Teilnehmer Karten aus vier Stapeln auswählen, durch die sie entweder Geld gewinnen konnten oder verlieren würden. Zwei Stapel beinhalteten eher kleinere Gewinne und Verluste – von 50 bis 100 Dollar. Was sie nicht wussten: bei diesem Stapel würden sie dauerhaft Gewinn machen. Die anderen beiden Stapel hatten höhere Beträge, die zu einem Verlust oder Gewinn von 500-1000 Dollar führten. Was den Teilnehmern aber in diesem Fall nicht klar war: im Laufe des Spiels würden diese Kartenstapel einen dauerhaften Verlust bedeuten. Natürlich entdeckten die Teilnehmer im Verlauf des Experiments irgendwann dieses Muster.
Das Spannende daran war, dass sich das Verhalten der Teilnehmer allerdings bereits geändert hatte, bevor sie selbst realisierten, warum. Damasio konnte durch messbare Signale des Körpers der Teilnehmer beweisen, dass ihr Körper ihr Lernen und Entscheiden sehr stark leitete: Die Hautleitfähigkeit der Teilnehmer (also die elektrische Leitfähigkeit der Haut, die mit der Menge des Schweißes auf der Haut zunimmt) begann nach einer kurzer Startphase des Spiels jedes Mal zu steigen, sobald sie die riskanteren Stapel in Betracht zogen. Ihre Körper reagierten bereits auf das unterbewusst wahrgenommene Risiko mit einer somatischen Reaktion – mehr Schwitzen. Und diese Reaktion leitete sie unterbewusst schließlich dazu, doch lieber Karten von den sichereren Stapeln zu ziehen, bei denen ihr Körper offenbar nicht diese Stressreaktion zeigte. Die Körpersignale nennt Damasio „somatische Marker“.
Soma = die Gesamtheit aus Körper, Seele und Geist
Daraus lässt sich ableiten, dass unser Bauchgefühl mehr ist als nur eine Metapher. Es ist tatsächlich etwas, das uns dank abgespeicherter Erfahrung all unsere kognitiven Prozesse – wie hier das Entscheiden – unterstützt. Oder um es genauer auszudrücken: kognitive, emotionale und somatische Prozesse im Körper sind lediglich drei verschiedene Komponenten des gleichen einheitlichen Prozesses. Das Eine gibt es ohne das Andere nicht.
Gerald Hüther leitet in seinem Text „Wie Embodiment neurobiologisch erklärt werden kann“ die nichttrennbare Einheit von Körper und Psyche sehr eindrucksvoll her. Er formuliert in einem Zwischenfazit:
„Das Gehirn und der Körper stehen in einer engen, untrennbaren Beziehung. Diese Beziehung ist nicht vom Himmel gefallen. Sie war von Anfang an da und hat sich im Verlauf der Herausbildung und Ausreifung körperlicher und zentralnervöser Strukturen in wechselseitiger Abhängigkeit ständig weiterentwickelt. Durch ihre gemeinsame Geschichte sind Körper und Gehirn daher auf ähnlich untrennbare Weiser miteinander verbunden, wie alles Lebendige, was sich miteinander entwickelt und in voreinander abhängiger Weise herausgebildet hat: Pflanzen und pflanzenfressende Tiere, Männer und Frauen, Politiker und ihre Wähler, Bücherschreiber und Bücherleserinnen. Das Eine ohne das Andere funktioniert nicht. Wenn sich eines von beiden verändert, muss das andere auf diese Veränderung reagieren – eine Wechselwirkung besteht.“
Embodiment als Wechselwirkung
Seine Mit-Autorin Maja Storch beschreibt in einem Text „Wie Embodiment in der Psychologie erforscht wurde“ daran anschließend:
„Wenn Menschen denken, fühlen und handeln, tun sie dies nicht wie körperlose Gespenster. Der Körper ist immer mit im Spiel. Nehmen wir zum Beispiel das Gefühl von Stolz. Schon Darwin war aufgefallen, dass das Gefühl von Stolz sich für alle Welt sichtbar in einer ganz bestimmten Körperhaltung zeigt: „Ein stolzer Mann drückt sein Gefühl von Überlegenheit über die anderen aus, indem er seinen Kopf und seinen Körper aufrecht hält. Er ist so hoch aufgereckt und macht sich selbst so groß wie möglich; so dass man metaphorisch davon sprechen kann, dass er wie angeschwollen oder aufgeblasen von Stolz ist.“ (Darwin, 1872/1965, pp. 263-264)
Diese Beobachtung von Darwin kann man aufgrund eigener Erfahrung sofort nachvollziehen, wenn man sich Menschen in Erinnerung ruft, die aus irgendeinem Grund von Stolz erfüllt sind. Ist der Grund aktuell neu eingetreten, wie zum Beispiel der erste Preis im Sackhüpfen beim Kindergeburtstag, sieht man einen kleinen Gewinner in dieser aufgerichteten Haltung herumSTOLZieren, so lange bis ein neues Ereignis das Gefühl von Stolz durch eine andere psychische Erfahrung ersetzt. Die Körperhaltung des Stolzes kann aber auch dauerhaft eingenommen werden, wie bei der 88jährigen adligen Offizierswitwe, die vor dem Zweiten Weltkrieg Gutsbesitzerin in Ostpreußen war.[…]
Das psychische Erleben, das von einem – äußeren oder inneren – Ereignis ausgelöst wird, muss außerdem auch keineswegs immer zu Bewusstsein kommen, um eine Veränderung der körperlichen Verfassung auszulösen. Diese Vorgänge verlaufen oft unbewusst. Die Autofahrerin merkt erst richtig, wie wütend sie über den Opi ist, der vor ihr auf der linken Spur der Autobahn mit 90 entlang tuckert, wenn sie sieht, dass die Knöchel ihrer Hand schon ganz weiß sind, weil sie ihr Lenkrad so festhält.“
Unsere Körpersignale – oder: somatische Marker
Die meisten von uns kennen das und wissen wie Ereignisse und unser inneres Erleben (dieser Ereignisse) zu Körpergeschehen führt. Der langsame Opi führt zu Genervtheit. Die führt zu Anspannung. Und die wiederum führt zu schlechter Durchblutung und damit zu weißen Fingerknöcheln. Deswegen nehmen wir in der Regel unsere Alltagserfahrungen auch in dieser Kausalität wahr: Ich tanze durch das Wohnzimmer, weil ich so glücklich bin, weil ich auf eine Party eingeladen wurde. Maja Storch leitet allerdings in ihrem Text in einen Aspekt ein, der aufzeigt warum Embodiment relevant für Selbstführung ist: Kann es vielleicht auch umkehrt sein: ich bin genervt, weil ich die Augenbrauen hochziehe? Die Abfolge von Ursache und Wirkung funktioniert genauso umgekehrt: Weil ich den Kopf hängen lasse, fühle ich mich unglücklich.
Manch einer kennt vielleicht das Stiftexperiment, das die drei Forscher Strack, Martin und Stepper 1988 mal durchführten: sie ließen Probanden einen Stift zum Schreiben entweder mit den Lippen festhalten oder mit den Zähnen – ohne Berührung der Lippen. Dabei wird entweder die fürs Lachen relevante Muskulatur blockiert, oder sie wird stark aktiviert. Das Ergebnis: die mit dem Lippen-Stift empfanden einen gezeigten Comic, deutlich weniger lustig, als diejenigen mit dem Stift zwischen den Zähnen. Denn sie hatten dadurch ihre Lachmuskeln aktiviert.
Emotionen haben immer eine körperliche Komponente (wie ihr im Beitrag „Emotionen und Führung“ lesen könnt). Daher ist jedes Ereignis, das wir in unseren Erinnerungen zusammen mit der Emotion abspeichern, auch mit einer Reihe von Körperempfindungen verbunden, die wir beim ersten Durchlaufen der Erfahrung verspürten. Einerseits erleben wir diese Empfindungen dann erneut, wenn wir uns in einer ähnlichen Situation befinden oder uns an sie erinnern. Andererseits können wir durch das Reaktivieren einer Körperempfindung – ein gesenkter Kopf, verschränkte Arme etc. – auch die Situation und die dazugehörige Emotion erneut erleben.
Embodiment: Realität und Weg zugleich
Machen wir nochmal den Versuch: Was ist dein peinlichster Moment im Leben gewesen? Erinnere dich nochmal daran – wie fühlte sich das an? Ziemlich wahrscheinlich fühlte es sich nicht allzu gut an. Wahrscheinlich kannst du wieder das Gefühl der Verlegenheit oder Scham erleben. Spürst du auch den körperlichen Schmerz, der aus den Veränderungen im Körper resultiert, weil wir verschwinden oder uns ganz klein machen wollen? Ein Loch in der Magengrube, der Körper sackt zusammen, die Brust fällt ein, die Waden werden schwach und der Kopf senkt sich.
Und umgekehrt: was können wir tun, um da wieder rauszukommen? Aufrichten, den Kopf heben, durchatmen, die Beine ausschütteln und den Brustkorb bewusst weiten. Das Einnehmen einer stolzen Körperhaltung wird wahrscheinlich genau das in uns auslösen: ein positives Gefühl. An dieser Stelle ist es wichtig, Embodiment von klassischen Körpersprachetechniken abzugrenzen. Wenn wir uns einfach nur antrainieren, erhobenen Hauptes zu lächeln, erreichen wir in vielen Fällen nur zunächst eine Verbesserung. Aber dauerhaft leider auch das Gegenteil von dem, was wir beabsichtigt hatten: wir wirken irgendwann unauthentisch – auf uns und andere.
Und dennoch gibt es hier einen Bereich von Embodiment, der besonders für das Thema Selbstführung relevant ist. Embodiment beschreibt nämlich nicht nur die Realität der Einheit von Körper, Geist und Seele. Es beschreibt auch den Weg, den wir im erwachsenen Leben bewusst gehen können, um uns dieser Einheit im Alltag bewusst zu werden. Und sie in der Selbstführung bewusster zu nutzen. Als Erkenntniswerkzeug ebenso wie als Hilfestellung bei gewünschten Veränderungen.
Embodiment (wieder) lernen müssen
Warum wir zunächst aber Embodiment (erst wieder) erlernen müssen, obwohl das doch eigentlich der menschliche Grundzustand ist: das beschreibt Gerald Hüther als die „Vertreibung aus dem Paradies“. Zum einen lernen wir aufgrund unserer Sozialisierung früh unseren Körperempfindungen nicht zu sehr zu vertrauen. Zum anderen haben wir manch wichtige Erfahrungen mit so starken Körpersignalen abgespeichert, dass wir alles tun, um der Erfahrung aus dem Weg zu gehen.
Er beschreibt das folgendermaßen am Ende dieses Absatzes: „Für die Herausbildung der Vorstellung von dem, was man selbst ist, spielt mit der einsetzenden Sprachentwicklung die Bewertung des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns durch andere wichtige Bezugspersonen eine zunehmend stärker werdende Rolle. Die inneren Repräsentationen, die das Selbstbild eines Menschen prägen, werden darum ganz wesentlich dadurch geformt, was man an Zuschreibungen und Bewertungen von anderen erlebt und verinnerlicht.
Aus diesem Grund enthält das Selbstbild eines Menschen oft Fremd-Komponenten, die nicht mit dem ursprünglichen Körper-Selbst übereinstimmen, das ja durch die eigenen Körpererfahrungen entstanden ist. Die „fremden“ Komponenten des Selbstbildes können das eigene Körper-Selbst sogar partiell überlagern, überformen und unterdrücken. Die Verbindung mit und damit auch der Zugang zum eigenen Körper ist dann mehr oder weniger stark blockiert.“
Daraus ergibt sich der zweite Punkt: warum wir aufgrund besonders starker Körpersignale bestimmten Erfahrungen immer wieder aus dem Weg gehen. Wir haben in frühen Jahren schon gelernt, der Rückmeldung anderer mehr Wert beizumessen als unseren eigenen. Warum? Hüther sagt: „Die allererste und wichtigste Aufgaben des Gehirns ist (und bleibt zeitlebens) nicht das Denken, sondern das Herstellen, Aufrechterhalten und Gestalten von Beziehungen.“ Damit sind vor allem Beziehungen im Körper, zwischen Zellen, zwischen Gehirn und anderen Organen gemeint. Diese Beobachtung gilt aber ebenso für die Beziehung zum Außen und damit auch zu unseren Mitmenschen.
Embodiment: die Beziehung zwischen dem Innen und dem Außen
Um akzeptierter Teil einer Gemeinschaft zu werden und zu bleiben, und damit seit Urzeiten das menschliche Überleben zu sichern, gehört das Unterdrücken eigener Bedürfnisse, das Annehmen der Bewertungen anderer zu den urmenschlichen Fähigkeiten. Da es ums Überleben geht, ist es auch verständlich, warum der Prozess des sich-an-die-Mitmenschen-Anpassens meist durch Angst gesteuert wird. Er wirkt somit kraftvoll in uns allen, wie Hüther ausführt. Während wir also so durch die ersten prägenden Jahre unseres Lebens gehen und dabei Erfahrungen, emotionale Erlebnisse und mit ihnen verknüpfte körperliche Reaktionen sammeln, entwickeln wir uns zu dem/der, der/die wir sind.
Die Herausforderung besteht nun darin, dass nicht alle diese in den ersten Jahren erlernten Muster für uns tatsächlich bis heute hilfreich sind. Ein Beispiel aus dem Bereich Leadership: Führung beinhaltet viele Situationen, in denen wir uns selbst sichtbar machen (müssen). Nun sind wir vielleicht aber in einer Umgebung aufgewachsen sind, in der Sichtbarkeit nicht sicher war. Wir denken da an eine Freundin, die in der DDR aufwuchs, deren Eltern Gegner des Systems waren und sich daher immer unauffällig verhalten mussten. Als kleines Mädchen lernte sie unsichtbar zu sein, den Blick zu senken, leise zu sprechen und sich nicht schnell zu bewegen.
Ist jemand so aufgewachsen, bringt ihn die Erfahrung des Sichtbarseins zurück zu den körperlichen Empfindungen von Gefahr. Das kann sich so anfühlen, als ob derjenige tatsächlich körperlich bedroht wäre, sobald er sich heute sichtbar macht. Ihr Sein ist bis heute davon geprägt, obwohl die Gefahr längst nicht mehr existiert. In ihrer Rolle als Führungskraft empfindet sie dieses Muster des Unsichtbarwerdens unter Stress als belastend. Auch wenn wir ganz anders und deutlich weniger traumatisierend aufgewachsen sind, gilt diese Art der Prägung übrigens für jeden von uns.
Veränderung braucht den Körper als Erfahrungsspeicher
Warum können wir in bestimmten Situationen nicht die sein, die wir gerne wären? Warum können wir nicht per kognitiven Entscheidung einfach ab jetzt in uns hineinwachsen? Oder unser Verhalten einfach ändern, wenn es doch nicht mehr angebracht ist? Nun macht es die Art, wie in unserem Gehirn, unserem Nervensystem und unserer Muskulatur diese Muster in uns entstanden und abgespeichert sind, tatsächlich recht schwierig, unser Verhalten einfach mal vom Kopf her zu ändern; selbst wenn wir etwas verstanden haben und kognitiv alles dafür tun, anders zu reagieren. Wenn der Körper nicht mitgenommen wird, neigt er dazu uns in die Quere zu kommen.
Die Forschung gibt uns zum Glück Aufschluss darüber, wie wir dennoch lernen können, Aspekte unseres automatisierten im Körper verankerten Verhaltens zu verändern, die uns in unserer Selbstführung nicht dienen. Dazu müssen wir uns darin üben, uns der abgespeicherten Empfindungen und dadurch ausgelösten Verhaltensmuster bewusst zu werden. Wir lernen zunächst mit ihnen zu arbeiten und von dort aus neue bewusste Praktiken aufzubauen und zu üben. Die übergeordnete Fragen, die uns dabei leiten, sind: Wie verkörpern wir unsere Erfahrungen? Wie verkörpern wir unsere Reaktionen?
Probiere es selbst mal für dich aus
Versuche einmal folgende Übung: Die Übung besteht darin, dass du dir einen ganzen Tag lang die Signale deines Körpers bewusst machst: Mit welcher Körperhaltung beginnst du deinen Tag und wie verändert sich diese im Laufe des Tages? Am besten nimmst du dir für diese Übung Zettel und Stift zur Hilfe und schreibst dir während des Tages Stichworte auf.
- Überlege zuerst: In welchen Situationen möchtest du die Signale deines Körpers wahrnehmen. Das kann zum Beispiel morgens beim Frühstück, auf dem Weg zu Arbeit, in der Interaktion mit Kollegen, während deines Feierabends mit deiner Familie sein.
- Suche dir zwei-drei Situationen im Laufe des Tages heraus und beantworte für jede dieser Situationen direkt während sie passieren folgende Fragen:
- Wie hängt gerade deine Körperhaltung, dein Körpergefühl oder die Empfindungen im Körper mit deiner Stimmung zusammen?
- Kannst du deine Gefühle verändern, indem du deine Körperhaltung bewusst veränderst?
Beispiel – vor dem Duschen morgens: „Mein Körper fühlt sich müde an. Meine Körperhaltung ist schlaff. Ich fühle mich energie- und lustlos.“ Versuche dich vor dem Spiegel zu strecken und aufrecht hinzustellen und Körperspannung zu erhöhen: „Meine Gefühl verändert sich nach kurzer Zeit, ich fühle mich etwas wacher, anwesend und lebendiger.”
Reflektiere am Ende des Tages, was du durch dieses Bewusstmachen deines Körpers und seiner Signale über dich gelernt hast. Wie geht es dir damit?
Storch, M., Cantieni, B., Hüther, G. & Tschacher, W.: Embodiment – Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen. Hogrefe, München 2010
Damasio, Antonio: Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. List, München 1994
Hamill. Pete: Embodied Leadership – The Somatic Approach to Developing Your Leadership. KoganPage, 2013